Dialog mit Heinrich Dingeldein und Georg Fülberth
 Marburg 23.3.2011 (red) Kurz vor der anstehenden Kommunalwahl veröffentlicht das Marburger. einen kommunalpolitischen Beitrag. Darin kommen zwei erfahrene und zugleich ausscheidende Stadtverordnete zu Wort, Heinrich Dingeldein (FDP) und Georg Fülberth (Fraktion Marburger Linke). Der Beitrag bietet einen Rückblick und Vorschau, Kritik und Gedanken darüber, wie es weitergehen sollte. Das Gespräch mit den beiden Marburgern hat am 10. März 2011 stattgefunden und ist aufgezeichnet worden. Zugleich eröffnet damit das Marburger. die neue Reihe dia log.
Marburg 23.3.2011 (red) Kurz vor der anstehenden Kommunalwahl veröffentlicht das Marburger. einen kommunalpolitischen Beitrag. Darin kommen zwei erfahrene und zugleich ausscheidende Stadtverordnete zu Wort, Heinrich Dingeldein (FDP) und Georg Fülberth (Fraktion Marburger Linke). Der Beitrag bietet einen Rückblick und Vorschau, Kritik und Gedanken darüber, wie es weitergehen sollte. Das Gespräch mit den beiden Marburgern hat am 10. März 2011 stattgefunden und ist aufgezeichnet worden. Zugleich eröffnet damit das Marburger. die neue Reihe dia log.
.
Redaktion: Herr Dingeldein, Sie scheiden als Stadtverordneter der FDP mit der jetzigen Wahlperiode aus und kandidieren nicht erneut. Wenn sie zurückblicken auf die letzten Jahre. Was ist wichtig gewesen und was ist geleistet worden in Marburg?
Dingeldein: Das ist eine schwierige Frage an einen Politiker, der in der Opposition war. Wir könnten eher darüber nachdenken, was geleistet hätte werden müssen und nicht geleistet worden ist…
Redaktion: Das wird die Frage zwei.
Dingeldein: Also erst mal bin ich ja so zu dem Mandat gekommen, wie es nur die Demokratie möglich macht: Es wurde kumuliert und panaschiert, und ich bin wie Herr Fülberth nicht durch eine Spitzenkandidatur, sondern durch Bürgerwille ins Stadtparlament gekommen.
Und was macht ein Liberaler im Parlament? Wenn er Glück hat, ist er Zünglein an der Waage. Große Massen bringt er nicht auf die Beine, also versucht er mit der Vernunft einzugreifen, Argumente zu liefern und vielleicht im Denken das eine oder andere zu bewegen. Ich glaube, dass gerade auf diesem Weg – nicht nur mir – das eine oder andere gelungen ist.
Wenn ich mir zum Beispiel die Anfangsphase des Umwelt- und Verkehrsausschusses ansehe, in dem es in den ersten Sitzungen vor allem darum ging, aufeinander einzuprügeln. Am Ende hat man sich 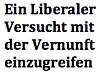 doch besser verstanden und Argumente auch aus der Opposition ernst genommen. Dass man erst einmal nachdenken kann und nicht, weil ein Vorschlag aus der falschen Ecke kommt, gleich dagegen sein muss, das wäre etwas vom Klimatischen her immer zu wünschen.
doch besser verstanden und Argumente auch aus der Opposition ernst genommen. Dass man erst einmal nachdenken kann und nicht, weil ein Vorschlag aus der falschen Ecke kommt, gleich dagegen sein muss, das wäre etwas vom Klimatischen her immer zu wünschen.
Ein relativ sinnvoll eingeschlagenen Weg war die erste Vorlage des städtischen Haushalts. Dass man das in Marburg vorhandene Glück mit höheren Steuereinnahmen dazu benutzt hat, Schulden abzubauen und trotzdem Investitionsmaßnahmen zu tätigen, das entsprach – bei aller Kritik am einen oder anderen Haushaltstitel – liberalen Vorstellungen.
Was wir als Unglück empfunden haben, war dann der Doppelhaushalt 2010/2011. Es wären gegen Ende der Legislaturperiode noch Dinge noch zu korrigieren und umzustellen gewesen.
Redaktion: Eine Nachfrage zum Thema Solarenergie. Dazu gibt es ja nunmehr das Solarkataster als breites Informationsmedium. Wie schätzen Sie den Marburger Weg ein im Verhältnis zur Notwendigkeit Richtung erneuerbare Energien zu gehen?
Dingeldein: In die Richtung erneuerbarer Energien zu gehen, ist heute auch bei Liberalen wirklich unbestritten. Dabei ist aber zu überlegen, ob man sinnvoll oder nicht sinnvoll vorgeht. Dazu ein Beispiel aus der großen Politik. Nicht alles was man gut machen will, wird dann auch gut. Dazu ein Beispiel für guten Willen mit schlechtem Ausgang aus der großen Politik: Jürgen Trittin war Umweltminister und wollte in die Geschichte eingehen als Retter des Mehrwegsystems mittels Dosenpfand. Im Ergebnis ist er allenfalls in die Geschichte eingegangen als GRÜNER Sozialpolitiker, weil sich die Einwegflasche noch schneller durchgesetzt hat und nun allenfalls ein Vorteil für die Ärmsten der Gesellschaft dabei herausgekommen ist, die die Möglichkeit Flaschen (und Dosen) für 25 Cent einzusammeln, gerne Nutzen. Eine richtige Entscheidung war das nicht. Die Wirkung des Dosenpfands ist bezüglich der Intention verpufft.
 Ähnliches kann mit einer falsch gesteuerten Regelung bezüglich der Energiewende geschehen. Diese ist notwendig, auch wir Liberalen warten nicht darauf, bis der Markt alles löst. Man muss aber viel Phantasie aufwenden. Es muss so sein, dass man erkennt, was widersprüchlich ist, zwar nicht unbedingt von der Idee her falsch, aber kontraproduktiv aus ökonomischem Blickwinkel. Daraus sich entwickelnde Fehler gilt es zu verhindern. Konkret zur Solarsatzung, dem Reizthema der letzten Legislaturperiode: Wenn man sieht, wie lange die Sonnenstunden bei uns in Marburg sind, wenn man sieht, was in erster Linie produziert werden sollte, nämlich warmes Wasser, und wenn man dann noch bedenkt, wo tatsächlich Energie gespart werden kann, wird deutlich, dass für alles erhebliche Investitionsmaßnahmen notwendig sind.
Ähnliches kann mit einer falsch gesteuerten Regelung bezüglich der Energiewende geschehen. Diese ist notwendig, auch wir Liberalen warten nicht darauf, bis der Markt alles löst. Man muss aber viel Phantasie aufwenden. Es muss so sein, dass man erkennt, was widersprüchlich ist, zwar nicht unbedingt von der Idee her falsch, aber kontraproduktiv aus ökonomischem Blickwinkel. Daraus sich entwickelnde Fehler gilt es zu verhindern. Konkret zur Solarsatzung, dem Reizthema der letzten Legislaturperiode: Wenn man sieht, wie lange die Sonnenstunden bei uns in Marburg sind, wenn man sieht, was in erster Linie produziert werden sollte, nämlich warmes Wasser, und wenn man dann noch bedenkt, wo tatsächlich Energie gespart werden kann, wird deutlich, dass für alles erhebliche Investitionsmaßnahmen notwendig sind.
Handelt es sich um öffentliche Maßnahmen, bezahlt sie der Steuerzahler, wenn es private Maßnahmen sind, kommen sie aus demselben Geldbeutel wie die Steuergelder auch. Da ist zu überlegen, was ist sinnvoll?
Auch wenn man jetzt ein Solarkataster hat, und es da und dort sehr sinnvoll sein kann, die Energie mittels Sonne zu erzeugen und zu nutzen, für den Einzelnen bleibt immer die Entscheidung, für was er das Geld einsetzt, und diese Freiheit soll ihm nicht genommen werden. Hat er zum Beispiel ein Haus aus den sechziger oder siebziger Jahren, wäre es gescheiter die Wände zu isolieren, als das warme Wasser per Solarthermie zu produzieren. Jeder hat das Geld nur einmal und muss entscheiden, was für ihn das Sinnvollere ist – sowohl im ökonomischen als auch im ökologischen Sinne. Wenn er aber gezwungen würde von einer Instanz, hier von der Stadt über eine Satzung, warmes Wasser zu produzieren, das er vielleicht kaum braucht, und alle anderen Maßnahmen können nur über komplizierte Ausnahmeregeln geleistet werden, dann ist das keine bürgerfreundliche Maßnahme. Und sie wird energetisch nicht den Erfolg haben. Weil dann mancher sagt, na dann warte ich mit den neuen Dachziegeln noch mal ein paar Jahre, vielleicht kommt dann noch eine bessere Idee, und er unternimmt im Sinne der Energieersparnis überhaupt nichts.
Redaktion: Herr Fülberth, wenn Sie zurückblicken, wobei ich jetzt nicht weiß, ob Sie die ganze Wahlperiode Stadtverordneter gewesen sind, was ist geleistet worden? Ist da etwas benennbar in Ihrer Wahrnehmung?
Fülberth: Ich war Nachrücker, bin 2007 nachgerückt, weil es Mandatsniederlegungen gegeben hat. Das ist sowieso meine Spezialität, meistens Nachrücker zu sein. 1990 bin ich für die DKP nachgerückt, 2007 dann für die Marburger LINKE. Zwischendurch war ich regulär gewählt, im Kreistag. Als ich dann nach 14 Jahren in die Stadtverordnetenversammlung zurückkam, war ich verblüfft und stark verunsichert von einer total veränderten Situation. Vorher war die DKP in der Stadtverordnetenversammlung, von 1972 bis 1993. Sie hat in diesen 21 Jahren keinen einzigen Antrag durchgebracht. Sie hat viele Anträge gestellt. Aber es war klar, DKP-Anträge werden abgelehnt. Im Kreistag war es ein wenig anders.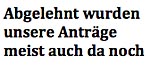 Da waren wir mit der SPD in der Opposition. Die SPD hat immer unsere Anträge evaluiert. Einige fanden sie unsinnig. Da waren sie dagegen. Aber sie haben sie mit uns gegen CDU, FDP, Freie Wähler und Republikaner gestimmt. Abgelehnt wurden unsere Anträge meist auch da noch.
Da waren wir mit der SPD in der Opposition. Die SPD hat immer unsere Anträge evaluiert. Einige fanden sie unsinnig. Da waren sie dagegen. Aber sie haben sie mit uns gegen CDU, FDP, Freie Wähler und Republikaner gestimmt. Abgelehnt wurden unsere Anträge meist auch da noch.
2007 kam ich in eine neue Situation und musste feststellen, diese kleine Fraktion hat eine ganz andere Funktion als bisher. Es ist ein kleiner Haufen. Nach wie vor wird sie von den anderen Fraktionen nicht für koalitionsfähig gehalten. Aber als kleine Fraktion waren wir doch eine, die Anregungen gemacht hat. Einige Anregungen sind aufgenommen worden, manchmal in ganz verqueren Konstellationen – zusammen mit der bürgerlichen Opposition. Manche Dinge haben wir angeschoben, die jahrelang nicht beachtet worden sind. Mit Verspätung ist etwas erreicht worden. Ständig haben wir, wie mit einer Gebetsmühle, erzählt, dass die Altenhilfe wieder in den Tarifvertrag des öffentlichen Diensts zurück soll. Es wurde abgelehnt. Jetzt, in einer wahrscheinlich nicht zufälligen Nähe zur Wahl, ist die Altenhilfe wieder drin. Wobei man nach einiger Zeit nicht mehr weiß, ob es die eigene Wirkung war, oder ob es sich von selbst ergeben hätte. Aber wir haben das doch gemacht.
 Dann haben wir gebohrt mit anderen, auch mit der IG MARSS, auf eine schärfere Einhaltung des Denkmalrechts und auch auf einen effizienteren und unparteilicheren, oder sagen wir unverdächtigeren, Gestaltungsbeirat. Auch das wurde abgelehnt, führte dann zu Konflikten innerhalb der Koalition. Jetzt hat der Oberbürgermeister aus unseren Vorschlägen und denen der IG MARSS eine Art Synopse und einen Vorschlag gemacht für eine neue Geschäftsordnung, eine neue Satzung des Gestaltungsbeirats mit mehr Sachkompetenz von außen. Das soll dann in der zweiten Sitzung der neuen Stadtverordnetenversammlung im Mai kommen.
Dann haben wir gebohrt mit anderen, auch mit der IG MARSS, auf eine schärfere Einhaltung des Denkmalrechts und auch auf einen effizienteren und unparteilicheren, oder sagen wir unverdächtigeren, Gestaltungsbeirat. Auch das wurde abgelehnt, führte dann zu Konflikten innerhalb der Koalition. Jetzt hat der Oberbürgermeister aus unseren Vorschlägen und denen der IG MARSS eine Art Synopse und einen Vorschlag gemacht für eine neue Geschäftsordnung, eine neue Satzung des Gestaltungsbeirats mit mehr Sachkompetenz von außen. Das soll dann in der zweiten Sitzung der neuen Stadtverordnetenversammlung im Mai kommen.
Ebenso haben wir ständig gejammert, Anträge gestellt im Haushalt, dass die Leistungen aus dem Sozialpaß erweitert werden sollen. Das wurde bei jeder Haushaltsberatung abgelehnt. Zuletzt als der Doppelhaushalt verabschiedet werden sollte – abgelehnt. Jetzt in großer Nähe zur Wahl sind einige Leistungen erweitert worden, auf Vorschlag der rot-grünen Koalition. Dieses sind Langzeitwirkungen, bei denen ich mit etwas Eigenlob sage, vielleicht ist es doch gut, dass es so eine kleine Fraktion wie die Marburger LINKE gibt.
Und es ist auch gut, dass alle fünf Jahre Wahlen sind, wo man das mal wieder berücksichtigen muss.
Redaktion: Sie haben jetzt beide Äußerungen auch zur politischen Kultur in Marburg gemacht. Herr Dingeldein und Herr Fülberth, wenn wir dann mal auf Negatives zu sprechen kommen. Es besteht in Marburg eine politische Kultur, die weit übergreifend ist. Wo der Liberale und der / Fülberth wirft ein „der Kommunist“. Mir erscheint das als besondere Qualität hier in Marburg, die, denke ich, Wahlkampf und alle möglichen inhaltlichen Unterschiede unbeschadet überstehen wird. Doch wäre es wichtig zu sagen, was ist eigentlich negativ? Was muss man da benennen?
Dingeldein: Das will ich ganz deutlich in Richtung der beiden momentan die Stadt regierenden Parteien richten: Dass die Kommunikation schlecht bis hundmiserabel gelaufen ist. Sehr deutlich erkennbar ist, dass wir Stadtverordneten nicht immer mit allen Informationen beliefert worden sind. Zum Beispiel als es um die Einrichtung der Windräder auf den Lahnbergen ging. Das war innerhalb der Koalition durchaus keine einige Angelegenheit. Es ist ja nachher durch den Rücktritt von Herrn Becker deutlich geworden, was gelaufen ist. Das sind so Dinge, die enttäuschen.
Vor allem aber auch der weite Bereich, was die Bauplanungen in Marburg angeht. Dass man erst sehr sehr spät informiert wird, was wo vorgenommen werden soll, und dies in eine Sprache gekleidet, die bestenfalls zu Missverständnissen Anlass gibt, aber im Endeffekt häufig als Unwahrheit erkannt werden musste. Das sind Dinge, die schwer wiegen.
Redaktion: Sie beklagen also eine mangelnde Transparenz, oder besser gesagt Informationsverhalten des Magistrats, von Seiten der Stadt, zu den Stadtverordneten hin?
Dingeldein: Das würde ich so sehen. Man muss sich vor Augen halten, dass die Hessische Gemeindeordnung, wie sie strukturiert ist, nicht davon ausgeht, dass man Regierung und Opposition hat. Wir spielen das jetzt zwar, übernommen von Land und Bund. Im Endeffekt ist jedoch gedacht, dass kooperativ gearbeitet werden soll.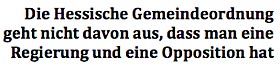 Das macht es dann auch möglich, dass über eine weite Distanz ein Vertreter des Eigentums (ein Liberaler) und ein Vertreter des Gemeineigentums (ein Linker) sich unterhalten können. Das wäre eine ganz andere Frage, glaube ich, wenn wir beide uns streiten müssten über Grundsatzfragen, also um Verstaatlichung bestimmter Institutionen, welche Verantwortlichkeit wird vom Staat übernommen, welche soll der Bürger für sich behalten dürfen. Da wären wir wahrscheinlich doch weit auseinander.
Das macht es dann auch möglich, dass über eine weite Distanz ein Vertreter des Eigentums (ein Liberaler) und ein Vertreter des Gemeineigentums (ein Linker) sich unterhalten können. Das wäre eine ganz andere Frage, glaube ich, wenn wir beide uns streiten müssten über Grundsatzfragen, also um Verstaatlichung bestimmter Institutionen, welche Verantwortlichkeit wird vom Staat übernommen, welche soll der Bürger für sich behalten dürfen. Da wären wir wahrscheinlich doch weit auseinander.
Redaktion: Herr Fülberth, sie haben geschildert, dass dank beharrlicher Arbeit einiges erreicht worden ist. Was war denn nicht in Ordnung?
Fülberth: Nicht in Ordnung war und ist nach wie vor eine gewisse Nachlässigkeit, vielleicht Großzügigkeit, oder Vertrauensseligkeit des Magistrats und des Baudirektors im Umgang mit Großinvestoren. Wir haben das Beispiel Rosenstraße, wo in sehr eigentümlicher Weise mit der Stadtverordnetenversammlung umgegangen wurde. Sie hat einen Aufstellungsbeschluss gefasst, in dem ein Kulturdenkmal drinstand, das Haus Rosenstraße 9. Inzwischen hatte der Investor, die DVAG, sein Interesse geltend gemacht, wonach dieses Kulturdenkmal zu verschwinden habe. Es ist verschwunden. Hier haben wir sehr viel vorauseilenden Gehorsam erlebt, von Seiten des Magistrats. Ich glaube der Magistrat erlebt so etwas, was die Franzosen embarass de richesse, Bedrängung durch Reichtum oder durch Überfülle, nennen.![]() Wir haben große Gewerbesteuerzahler, davon lebt der Haushalt in erheblichem Maße. Ich habe den Eindruck, dass sich der Oberbürgermeister und auch der Bürgermeister mitunter davon entbunden fühlen eigene Vorstellungen zu entwickeln.
Wir haben große Gewerbesteuerzahler, davon lebt der Haushalt in erheblichem Maße. Ich habe den Eindruck, dass sich der Oberbürgermeister und auch der Bürgermeister mitunter davon entbunden fühlen eigene Vorstellungen zu entwickeln.
Wir haben den Planungsvorgang zwischen der Rosenstraße und der Lahn praktisch abgegeben an einen privaten Investor. Das haben wir in einigen anderen Fällen ähnlich. Das Marktdreieck ist vergleichbar entstanden, auch das Erlenring-Center. Ich fürchte, dass nach der Wahl die Vorstellungen der Firma Tenkhoff Properties in ähnlicher Weise realisiert werden werden. Da haben wir nun die Macht des großen Geldes.
Auf der anderen Seite sehen wir, dass eine Politik der Haushaltsabsicherung deutlich zu Lasten der Schwächeren geht. Es sind die Marburger Entsorgungsgesellschaft (MEG) und Marburger Verkehrsgesellschaft (MVG) ausgegliedert worden aus den Stadtwerken. Damit können sie niedrigere Löhne zahlen. Das erlaubt den Stadtwerken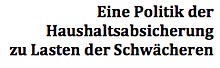 wiederum von Zeit zu Zeit gute Gewinnabführungen an den Haushalt zu geben. Das heißt, der vom Oberbürgermeister so genossene angenehme Haushalt hat seine Schattenseiten. Die Hörigkeit gegenüber großen Investoren bringt Druck auf diejenigen, die es nicht so dicke haben.
wiederum von Zeit zu Zeit gute Gewinnabführungen an den Haushalt zu geben. Das heißt, der vom Oberbürgermeister so genossene angenehme Haushalt hat seine Schattenseiten. Die Hörigkeit gegenüber großen Investoren bringt Druck auf diejenigen, die es nicht so dicke haben.
Redaktion: Herr Dingeldein, wie schätzen sie den Umgang mit dem Marburger Bauboom ein, bezogen auf große Privatinvestoren oder institutionelle Investoren, wie die DVAG oder Tenkhoff Properties. Hat die Stadt das im Griff in richtiger Weise?
Dingeldein: Die Kritik der Stadt an bestimmten Planungen ist so beschränkt, wie wir sie dummerweise erleben. Es ist natürlich auch eine Aufgabe des Stadtparlaments genau dort die kritischen Fragen zu stellen. Solche sind auch von unserer Fraktion immer gekommen. Wenn man Marburg betrachtet, wie es sich heute darstellt, und das zugleich in historischer Perspektive begreift, wird erkennbar, dass diese Stadt seit der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert geplant worden ist als grüne Gartenstadt. Dass man dann vernünftigerweise immer Mal gesagt hat, wir können die Stadt nicht immer nur nach außen ausdehnen, wir müssen dann auch Baulücken schließen, ist die eine Angelegenheit.
Aber eine Stadt lebt vor allen Dingen von der architektonischen Qualität. Ich denke, dass da manchmal zu schnell klein bei gegeben wird. Dass, was sich rechnen muss, wird wichtiger als die Gestaltung.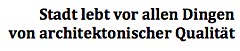 Nach alten Vorstellungen sollten Bauten und Quartiere Jahrhunderte halten. Heutige Bauten sind nach 40 Jahren nicht mehr brauchbar. Man denke nur an die Türme an der Autobahn, die öffentliches Eigentum der Universität sind.
Nach alten Vorstellungen sollten Bauten und Quartiere Jahrhunderte halten. Heutige Bauten sind nach 40 Jahren nicht mehr brauchbar. Man denke nur an die Türme an der Autobahn, die öffentliches Eigentum der Universität sind.
An meinem ersten Tag in Marburg 1972 musste ich bei der Fahrt durch Marburg in der Universitätsstraße anhalten, weil gerade das Gymnasium Philippinum abgebrochen wurde.
Das würde man heute nicht mehr gestatten. Aber man ist heute noch lange nicht so gut, um architektonische Alternativen wirklich zu bedenken. In dem Spagat zwischen kulturellem Anspruch, den die Stadt Marburg immer erheben muss, zwischen guter Architektur und Erfordernissen der Wirtschaft, gibt es breite Schneisen, die man gemeinsam begehen kann, wenn man nur will. Das bedeutet natürlich, dass die Stadt dort ihre Stellung als Gestalterin wahren und wahrnehmen muss.
Redaktion: Vor einigen Jahren hat in Marburg ein signifikanter Prozess eingesetzt. Bei der Universität wird dies von dem Programm HEUREKA getragen. Es wird umfassend gebaut und umstrukturiert. Es wird zwei Campusanlagen geben, eine im Lahntal, eine auf den Lahnbergen. Damit passiert eine Verdichtung, Aber zugleich gibt es in hohem Maße Privatinvestoren, die losgelegt haben oder loslegen wollen und im dreistelligen Millionenbereich in die Stadt eingreifen. Hier ist ein mächtiger Umgestaltungsprozess begonnen worden.
In ihren Augen als ausscheidender Stadtverordneter und Kommunalpolitiker, Herr Fülberth, worauf kommt es an in Marburg für eine positiv gestaltete Entwicklung?
Fülberth: Es kommt darauf an, dass man sagt: man will planend gestalten. Das neuzeitliche Marburg ist eine geplante Stadt gewesen. Dies meint nicht das mittelalterliche Marburg, als die Bebauung am Schlossberg allmählich gewachsen ist. Die heutige räumliche Struktur der Stadt ist wesentlich bestimmt durch gezielte Stadtplanung um das Jahr 1900.![]() Die Spange vom Bahnhof bis zur Gisselberger Straße ist ein großer Wurf gewesen. Das haben die Preussen geplant. Das bestimmt das Marburger Stadtbild heute wie das Mittelalter. Das war der erste große Stadtplan.
Die Spange vom Bahnhof bis zur Gisselberger Straße ist ein großer Wurf gewesen. Das haben die Preussen geplant. Das bestimmt das Marburger Stadtbild heute wie das Mittelalter. Das war der erste große Stadtplan.
Dann ist Marburg zur geplanten Stadt geworden in einer Weise, die wir heute nicht sonderlich positiv bewerten. Das war in der Zeit von Oberbürgermeister Gassmann. Die Stadtautobahn ist vorbereitet worden, nach seinem Ausscheiden vollendet worden. Dann diese beiden Riesenbrücken, am Bahnhof und am Erlenring. Das war der Geist der sechziger Jahre.
Immerhin ist der Richtsberg gebaut worden. Das bewerte ich positiv, wenn man vergleicht mit der Zeit der Planlosigkeit, die danach begonnen hat.
Wir haben noch einmal einen großen Plan gehabt, Drechslers Plan der Altstadtsanierung. In diesem Zusammenhang ist noch ein neuer Stadtteil entstanden, Weidenhausen Süd. In den neunziger Jahren kam die Umnutzung vormaliger Kasernengebäude und -flächen. Dann hört es auf. Es wird nicht mehr geplant, es wird gewuchert, auch im doppelten Sinn des Wortes meinetwegen.
Wenn man auf dem Schlossberg geht, kann man es sehen. Man sieht den geplanten Stadtteil Richtsberg, immerhin eine Ansiedlung für 8.000 bis 10.000 Menschen. Man könnte einwenden, idyllisch ist das nicht. Aber es hat eine Stadtgestalt. Schaut man rechts daran vorbei, kommt Cappel in den Blick. Dort steht ein Bungalow neben dem anderen, das bedeutet weit größeren Flächenverbrauch. Dies ist eine Schädigung gewesen, ohne Eigenheimbesitzern zu nahe treten zu wollen.
Jetzt hat sich erwiesen, es wäre besser, wieder zu planen. Deshalb haben wir den Antrag gestellt, dass ein Stadtentwicklungsplan aufgestellt werden soll. Das war die große Idee der 70er Jahre, als Stadtrat Gotthold hierher kam. Ich war völlig verdutzt, als man im Bau- und Planungsausschuss man von Seiten der GRÜNEN erzählte, das sei überholte Planwirtschaft, damit könne man nichts anfangen.
Wenn die öffentliche Hand nicht plant, planen eben andere.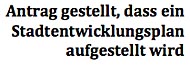 Dann planen große Investoren und das Land Hessen. Die Campus-Planung ist eine Hessen-Planung gewesen. Es ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden zwischen Stadt, Land und Universität. Die hat so gut wie nie getagt. Wenn sie getagt hat, wurde abgenickt. Das Land hat praktisch die Planungshoheit gehabt und der Oberbürgermeister hat sich um Transparenz bemüht. Viel mehr als Public Relation ist nicht rausgekommen. Es sieht aus, als ob es trotzdem gelungen wäre. Für die Zukunft brauchen wir einen Stadtentwicklungsplan.
Dann planen große Investoren und das Land Hessen. Die Campus-Planung ist eine Hessen-Planung gewesen. Es ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden zwischen Stadt, Land und Universität. Die hat so gut wie nie getagt. Wenn sie getagt hat, wurde abgenickt. Das Land hat praktisch die Planungshoheit gehabt und der Oberbürgermeister hat sich um Transparenz bemüht. Viel mehr als Public Relation ist nicht rausgekommen. Es sieht aus, als ob es trotzdem gelungen wäre. Für die Zukunft brauchen wir einen Stadtentwicklungsplan.
Redaktion: Ein Stichwort dafür ist Masterplan Lahnberge. Der liegt vor.
Fülberth: Für die Lahnberge ja. Aber was passiert zum Beispiel mit den Außenstadtteilen? Nur zu sagen, es muss mehr geplant werden, sagt wenig. Es kann verfehlt geplant werde, wie es unter Gassmann passiert ist. Aber gegenüber dieser wuchernden Struktur brauchen wir eine geplante Struktur.
Dingeldein: Bezogen auf das, was in der Stadt noch zu retten ist. Nicht überall, wo in der Stadt eine Lücke ist, ist das eine Baulücke. Es ist durchaus in der Planung vorgesehen gewesen, Bereiche als Grünzug zu behalten. Es waren eigentlich schon Planungsfehler von der ursprünglichen Struktur her jedoch akzeptable, beim Bau des Verwaltungsgebäudes und des Hörsaalgebäudes. Dieser Bereich sollte ursprünglich als Grünfläche freigehalten werden.![]() Es gibt viele solcher Maßnahmen. Wenn man die Universitätsstraße (stadteinwärts) entlang fährt, ist auf der linken Seite Bebauung mit zum Teil miserabel schlechter Architektur. Dort wurde eine Freifläche zugebaut, für die eigentlich gedacht war, dass man dort entlang laufend den Schlosshang sieht. Die alten Häuser haben nach Süden hin ihre Schmuckseiten. Dies sind alles Dinge, die damals im Blick waren.
Es gibt viele solcher Maßnahmen. Wenn man die Universitätsstraße (stadteinwärts) entlang fährt, ist auf der linken Seite Bebauung mit zum Teil miserabel schlechter Architektur. Dort wurde eine Freifläche zugebaut, für die eigentlich gedacht war, dass man dort entlang laufend den Schlosshang sieht. Die alten Häuser haben nach Süden hin ihre Schmuckseiten. Dies sind alles Dinge, die damals im Blick waren.
Es geht noch ein Stück weiter. Dies ist allerdings bei der Marburger „grünen“ Grundstimmung schwierig zu sagen. Es wird den Leuten nicht klar, dass Architektur und nicht nur Natur in die Stadt bringen, Lebensqualität bedeutet. Dass zum Beispiel die Baumbepflanzungen in Marburg fast schon an einen germanischen Baumkult erinnern.
Aber es gibt Straßen, da gehören Bäume einfach nicht hin, weil sie nicht vorgesehen waren. Es war beispielsweise in der Deutschhausstraße von den Planern vorgesehen, dass dort keine Schatten durch Bäume geworfen werden, sondern dass man ungehindert die Schaufassaden betrachtet kann und diese nicht durch Grün zugestellt werden. Überall dort, wo wir eine Nord-Süd-Erstreckung haben, wo also die Sonne nur einen kurzen Moment am Mittag hinein scheint, waren hingegen Alleen vorgesehen, wie etwa in der Haspelstraße. Die waren damals viel klüger als wir es heute sind.
Die waren damals viel klüger als wir es heute sind.
Ich möchte dafür plädieren, dass dieser Geist in der Stadtplanung wieder einzieht. Dass man nicht alleine sagt, was machbar ist, sondern auch wie es aussehen soll. Der Unterschied zwischen einem Bauplan und der großflächigen Gestaltung muss ins Bewusstsein treten.
Man betrachte nur das Marktdreieck. Als bei Oberbürgermeister Möller die Pläne dafür an der Wand hingen, da sahen die Gebäude mit einer davor gezeichneten Baumsilhouette akzeptabel aus. Man muss aber verstehen, dass zu Marburg gehört, dass man vom Lahntal blickend die Stadt und den Schlossberg sieht. Und in den letzten Jahren ist dafür gesorgt worden, dass man fast von nirgends mehr das beeindruckende Panorama sehen kann. Außer man geht in die neu gebauten Häuser hinein und schaut von Fahrstuhlschächten hinaus. Das kann nicht Vorbild für eine gelungene Stadtplanung sein. Dass mittlerweile das ganze Lahntal verbaut wurde, ist bestimmt kein gutes Ding.
Wir müssen uns in Marburg über eines klar werden – was wir sein wollen. Wir sind von der Anmutung her eine Kleinstadt, und wir haben hier eine Universität, die mal größer und mal kleiner erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber sie ist weit über die Grenzen hinaus bedeutend. Wir haben in Mittelhessen und in ganz Hessen unterschiedliche Entwicklungen bezogen auf die Bevölkerung. Es gibt eine starke Abwanderung im Norden und im Vogelsberg, Hier im engeren Bereich um Marburg haben wir Zuwanderung und einen Ausbau.
Es gibt in Hessen die Sonderstatusstädte 50.000 Einwohner bis 100.000 und die Großstädte mit über 100.000 Einwohnern. Die Marburger sollten anfangen sich Gedanken zu machen, was sie in Zukunft anstreben.
Wetzlar und Bad Homburg krebsen um die 50.000er Marke, wenn sie die unterschreiten, sind sie keine Sonderstatusstädte mehr. Die Stadt Rodgau kratzt an der 50.000er Marke von unten, Oberursel kratzt an der 50.000er Marke von unten. Wir können davon ausgehen, dass wir in den nächsten zehn Jahren darüber diskutieren müssen, dass wir eine neue Struktur brauchen in der Raumordnung.
Wenn man sich überlegt, dass Lahntal, Weimar und Cölbe eigentlich Marburger Randlagen sind, sollte Marburg einmal den Mut haben zu überlegen, ob man nicht mit diesen umliegenden Gemeinden gemeinsam die Zukunft betrachtet. Nicht gegen sie oder in Konkurrenz zu ihnen. Weil wir nämlich mit diesen Gemeinden die 100.000 überschritten hätten. Wir wären eine Großstadt. Wir hätten die Gestaltungsfreiheit, die eine Großstadt hat.![]() Gießen wäre in dieser Hinsicht keine Konkurrenz. Die liegen gewaltig dahinter. Mit Wetzlar zusammen ist das Projekt Lahnstadt schon vor Jahrzehnten schief gegangen. Aus diesem Grunde glaube ich, dass man etwas größer denken muss. Man sollte erkennen, dass Marburg eine neue Stadt werden kann. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Wirtschaft und die Universität weiter entwickeln werden.
Gießen wäre in dieser Hinsicht keine Konkurrenz. Die liegen gewaltig dahinter. Mit Wetzlar zusammen ist das Projekt Lahnstadt schon vor Jahrzehnten schief gegangen. Aus diesem Grunde glaube ich, dass man etwas größer denken muss. Man sollte erkennen, dass Marburg eine neue Stadt werden kann. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Wirtschaft und die Universität weiter entwickeln werden.
Redaktion: Dazu einen Aspekt, diese Gedanken aufgreifend. Ist das, was über die Stadtwerke gemacht wird, Kommunalisierung und Rekommunalisierung, zum Beispiel im Bereich der Stromnetze, dafür ein geeignetes Mittel?
Fülberth: Einfach, mit einem Wort: ja
Dingeldein: Ja, wobei ich da noch eine Klammer setzen muss. Wenn man jetzt durch den Landkreis geht, sind, was die Stromversorgungsnetze angeht, auch andere Entscheidungen getroffen worden. Im Kreis regiert dieselbe Partei mit, die hier den Bürgermeister stellt in Marburg. Dort war man sehr froh, dass man von EON zwei Millionen Euro Gewinnbeteiligung erhalten hat. Über diese Dinge muss noch länger diskutiert werden. Aber im großen Ganzen ja, das ist genau dieser Weg. Aber den sollte man auch politisch gehen wollen und das nicht irgendwo vergessen.
 Der zweite Teil des Gesprächs mit Heinrich Dingeldein und Georg Fülberth, die beide Professoren der Philipps-Universität Marburg sind, beschäftigt sich mit Fragen und Gedanken zur Marburger Hochschule. Damit wird die neue Reihe dia log in das Marburger. im Monat April fortgesetzt und vertieft. —> Per Mausklick zum zweiten Teil des Gesprächs.
Der zweite Teil des Gesprächs mit Heinrich Dingeldein und Georg Fülberth, die beide Professoren der Philipps-Universität Marburg sind, beschäftigt sich mit Fragen und Gedanken zur Marburger Hochschule. Damit wird die neue Reihe dia log in das Marburger. im Monat April fortgesetzt und vertieft. —> Per Mausklick zum zweiten Teil des Gesprächs.










